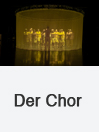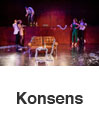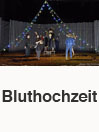Prinz Friedrich von Homburg
Bühne
Text: Heinrich von Kleist
Regie: Katja Langenbach, Kostüme: Julia Ströder, Musik: Jakob Diehl
Theater St. Gallen
Premiere: 13.11.09
St.Galler Tagblatt, 16.11.2009 von Peter Surber
Im seelischen Kriegszustand
Die jüngste St. Galler Schauspielpremiere ist auch räumlich eine Premiere: Kleists Prinz Friedrich von Homburg spielt im Saal, das Publikum sitzt auf der Bühne. Und erlebt zwei Stunden packendes Theater.
Krieg ist der Bruch. Die Katastrophe. Krieg ist die Verkehrung aller zivilen Verhältnisse in ihr Gegenteil, die Barbarei. Krieg ist das Andere, das Unsagbare, Unspielbare. Wie lässt sich daraus Theater machen – zumal aus der Optik einer verschonten Generation,die, anders als Kleist und seine Zeitgenossen vor zweihundert Jahren, die Allgegenwart von Krieg und Schlachterei nie erlebt hat? Krieg spielen? Das will sie nicht, die gut dreissigjährige Münchner Regisseurin Katja Langenbach und ihr ebenso junges Team (Bühnenbildnerin Hella Prokoph, Ausstatterin Julia Schröder und Komponist Jakob Dich]).
Sieg über die Bühnenenge
Dafür stellt sie die Theaterverhältnisse auf den Kopf. Kriegsschauplatz in St. Gallen ist nichtdie Bühne, sondern der Zuschauerraurn.
Das Publikum wird via schmale Treppen über die die Hinterbühne, durch „Medea“- und andere Kulissen, auf die Bühne gelotst und blickt auf seine sonstigen Plätze, die für einmal dem Ensemble gehören. Nichts und keiner bleibt auf seinem Platz – das ist ein sprechendes Bild für den Krieg als Zustand. Und ein triumphaler Sieg über die sonst beengten Bühnenverhältnisse. So viel Weite, Tiefe und Höhe war nie im Theater. Ein freier Platz vorn, ein rampenartiger Aufstieg links hinauf zu den obersten Rängen, von wo aus die Offiziere den Schlachtverlauf bei Fehrbellin kommentieren und wo später der Kurfürst residiert. Spielplätze zuhauf, Märsche durch die Sitzreihen, Befehlserteilung vom Balkon herab, Riesendistanzen, wie sie der Krieg zwischen Menschen aufreißt: Die theatralische Innenarchitektur des Paillard-Baus ist wie gemacht für großes Drama.
Die Regie setzt im Raum klare Feldzeichen, Keinerlei Schlachtgewühl- das ganze Kriegsgeschehen steckt in der Musik, die motorisch hämmert, Streicher kreischen lässt und bedrohlich gewittert in Szenen und Pausen. Die Farben hat der Krieg, der große Gleichmacher, dagegen gekillt.
Ein Schicksal zum Zerreißen.
Der Saal ist mit schwarzem Plastik vollständig ausgelegt, schwarz sind die Ringe unter den geröteten Augen der übernächtigten Soldaten und der zum Kriegsglück und -unglück mitverdammten Frauen, Kurfürstin und Prinzessin. Grau die Uniformen. Golden glänzt einzig der Patronengurt, den der Kurfürst wie einen Schal trägt und den er dem Homburg zur (fast möchte man sagen: Dornen-)Krone windet. Die Messias-Assoziation ist nicht ganz abwegig. Homburg kommt aus der Unschuld, ein Tor und Träumer. Ein weißer Seidenvorhang verdeckt zu Beginn den Saal, auf ihm tanzen Homburgs Traumgestalten von Heldenruhm und Liebesglück als riesige Schatten – bis er aufwacht und sich schreckensvoll ins Tuch wickelt. Später hängt er, als Gefangener, in den Seilen wie gekreuzigt. Seine Schuld scheint zuerst lässlich, er hat im Gefecht bloß zu früh, gegen kurfürstlichen Befehl, angegriffen. Wird trotz seines Siegs zum Tod verurteilt, dann begnadigt um den Preis, sich sein Todesurteil noch einmal selber zu fällen: ein Schicksal zum Zerreißen, wie stets bei Kleist.
Starke Charakterzeichnung
Das zeigt Nikolaus Bendas starke Charakterzeichnung in allen Facetten, im sprechenden Mienenspiel, im ratlosen Herabhängen der Arme, im Stolpern, im raschen Umschlag von Traulichkeit zu Trotz. Noch in der höchsten Selbstüberwindung, im Ja zum Todesurteil ist Bendas Homburg eher introvertiert als pathetisch; kein Held, ein Bub, der mit aufgerissenen Augen ins Getümmel um Leben und Tod geraten ist. Neben ihm die gegensätzlichen Frauen: Boglarka Horvaths Natalie verkörpert den sprühenden Glauben ans Leben, während die Kurfürstin (Diana Dengler) sich in Sorge verkrampft. Alexandre Pelichet spielt den Kurfürsten imposant mit Rückgrat. Seine Soldaten sind wie er selber keine Haudegen, sondern Kriegspragmatiker mit Ermüdungserscheinungen: Hans-Rudolf Spühler, Hannes Perkmann, Matthias Albold und Marcus Schäfer.
Wenn sie da stehen und reden, wird Kleists schwierige Sprache selbstverständlich. Für einmal erlebt man Sprechtheater mit Mikroports verstärkt – ein kluger Entscheid bei den weiten Spieldistanzen. Doch liegt’s nicht allein daran, dass man jedes Wort versteht. Katja Langenbach choreographiert die Szenen einfach, aber klar, mit Verdichtungen und präzis gesetzten Generalpausen, übersetzt den Kleist’schen Satzbau in räumliche Beziehungsgrammatik.
Der komplexe Mensch
Und immer in der Mitte: Homburg, der Mensch im inneren Kriegszustand. «Gleichviel» sagt er immer wieder, Kleists altes Wort für «trotzdem» – ein Wort, das Gegensätze zusammendenkt. Das ist die humane Botschaft dieser Inszenierung. Sie stellt der Barbarei des Schlachtens und des Gesetzes den leibhaftigen Menschen entgegen, komplex, zwiespältig und liebenswert. Sie spannt in die Schwärze des Raums ein weißes Tuch, das ein verletzliches Band zwischen Homburg und Natalie knüpft. Am Ende aber fehlt dieses Tuch, das Finale ist illusionslos: Homburg lebt, doch im Gestammel von «Sieg» und «Staub» hört man schon das Donnergrollen des nächsten Kriegs.
Der Landbote, 17.11.2009 von Martin Kraft
Verkehrte Bühne-Hellwaches Traumspiel
Seine Modernität beweist Kleists «Prinz Friedrich von Homburg» im Theater St. Gallen eindrücklich allein schon durch die ungewöhnliche Szenerie.
ST. GALLEN – Das Publikum wird auf die Bühne gebeten. Und es darf von hier aus seinen gewohnten Aufenthaltsort als sehr vielseitigen Spielort entdecken. Der Zuschauerraum wurde von der Bühnenbildnerin Hella Prokoph schwarz wie mit Kehrichtsäcken ausgekleidet – vielleicht, weil der Krieg ja heute, anders als zu Kleists Zeiten eine so «saubere» Sache ist?Jedenfalls macht die Sache großen Effekt. Und so wird der vertraute Raum auf einmal zur großzügigen Terrassenlandschaft mit einer Fülle unterschiedlicher Auftrittsmöglichkeiten.
Die Regisseurin Katja Langenbach hat sie klug genutzt, gerade wenn sie die Mitspielenden in stets wechselnden Konstellationen in großer Distanz voneinander agieren lässt und damit den zentralen Konflikt zwischen dem Individuum und der Gesellschaft augenfällig macht, Sie hat (ohne Pause) im richtigen Tempo inszeniert und dabei doch den wortreichen Auseinandersetzungen die gegen den Schluss die eigentliche Handlung ausmachen, genug Raum gegeben. Ohne sich um Zeitkolorit oder vordergründige Aktualisierung zu bemühen, kam auch Julia Ströder als Gestalterin der originellen Kostüme aus. Sie erfreuen mit bemerkenswerten Einfällen, ohne dass man genau zu wissen braucht, weshalb die f Kurfürstin (Diana Dengler) als Salondame, Natalie (Boglarka Horvath) dagegen in einem Militärhemd auftritt. Vom Kampf- und Kriegsgeschehen ist – außer den nur angedeuteten Uniformen und einem sinnvollerweise auch als Lorbeerkranz fungierenden Patronengürtel – nichts zu sehen. Um so intensiver ist es präsent in der ungemein suggestiven Musik von Jakob Diehl, die sich glücklich frei hält von naturalistischen Klängen und entsprechend prekären Anklängen an Historienfilme.
Während zu Beginn der Zuschauerraum noch von einem transparenten weißen Vorhang verdeckt wird, ist dieser sogar eine Zeit lang das einzige Geschehen. Dann tritt in einer ebenso überraschenden wie einleuchtenden Umkehrung der ersten Szene der Prinz vor diesen Vorhang, nicht träumend, sondern hellwach. Doch was sich nun als überdimensionales Schattenspiel hinter der weißen Wand bewegt, wirkt dann doch genau wie ein Traum, in dem man alles sieht und doch nichts ergreifen, in nichts eingreifen kann. Nikolaus Benda ist ein sehr unheldischer Titelheld, eher ein Zeitgenosse, der das Heldenzeitalter hinter ich gelassen hat, voll von starken Gefühlen, aber in seiner Selbstsuche auch echt selbstverliebt – einer, der von der Notwendigkeit des Kriegsrechts wenig hält oder sie gar nicht kennt. Wenn er zum Zeichen seiner Gefangennahme wie für einen Gleitschirmflug eingeschirrt wird, dann führt der vermeintliche Gag bald zu einem Höhepunkt des Abends, wo der zum Tode Verurteilte in seiner Verzweiflung buchstäblich den Boden unter den Füssen verliert. Und es ist nur konsequent, wenn er zum prekären glücklichen Ende nicht in den Kampfruf gegen die Feinde Brandenburgs einstimmt, sondern murmelnd im Traumdunkel verschwindet.
Präzise ausbalanciert ist das Verhältnis des Prinzen zu seinem Ersatzvater, der zugleich zu seinem Gegenspieler wird. Der Kurfürst (Alexandre Pelichet) erscheint von seiner Verpflichtung zu einem übergeordneten Kriegsrecht durchdrungen, aber dort wo dieses ihm Raum lässt, vor allem als ein Mensch voller Mitgefühl.
Neue Zürcher Zeitung, 17.11.2009 von Tobias Hoffmann
Sieger ohne Gnade
Kleist am Theater St.Gallen
Wie weit kann eine Regisseurin das komplexe Zeichensystem einer Inszenierung überhaupt kontrollieren? Wie sehr kann sie ihre künstlerische Absicht und das Ergebnis in Übereinstimmung bringen? Fast gar nicht, möchte man im Falle der St. Galler Produktion von Kleists «Prinz Friedrich von Homburg» antworten. Die junge Katja Langenbach skizziert im Programmheft zur Inszenierung ihre Sicht auf den Stoff. In der Titelfigur, dem preußischen General, der in einer wichtigen Schlacht entgegen der Ordre des Kurfürsten zu früh eingreift, dann aber, trotz oder gerade wegen seines Ungehorsams, den Sieg erringt, vom Kurfürsten dennoch zum Tode verurteilt, schließlich aber begnadigt wird, nachdem er selber das Urteil für zutreffend befunden hat – in dieser so sperrigen, träumerische und martialische Züge aufs merkwürdigste vereinigenden Figur erkennt Langenbach «den ersten komplexen Menschen der Moderne», der es schaffe, «dem System, repräsentiert durch den Kurfürsten, die Stirn zu bieten, sich zu behaupten und seine eigene Freiheit zu postulieren».
Den Satz von der «eigenen Freiheit» widerlegt die Inszenierung gründlich. Wir sehen Prinz Friedrich von Homburg (Nikolaus Benda) zu Beginn vor dem Vorhang in der Pose des berauschten Triumphators und erfahren bald, dass er ein Sieger ohne Gnade ist. Wir sehen ihn am Schluss auf dem Hosenboden sitzend, betäubt vor Glück, ein begnadigter Besiegter, der alles aus der Hand des gnädigen Fürsten empfängt: das Leben, die Liebe, den Ruhm.
Die an dialektischen, so gar nicht preussisch-geradlinigen Wendungen reiche Handlung erscheint als aufwendige Disziplinierungsmaßnahme des Kurfürsten (Alexandre Pelichet). Ihr Ausgangspunkt ist dessen Ausruf «Ins nichts mit dir zurück, Herr Prinz von Homburg» im Moment, als der in die Prinzessin Natalie verliebte Homburg diese im Größenwahn als seine Braut tituliert. Der Ausruf klingt in Pelichets Munde beinahe hasserfüllt, und auch seine späteren Interventionen sind geprägt von einer Härte und Berechnung, die nichts von väterlichem Wohlwollen verrät. Dieser Kurfürst schätzt nicht den Prinzen als Person, sondern sein militärisches Potenzial hoch und trachtet danach, es ganz unter seine Kontrolle zu bringen. Die Inszenierung zeigt nun das manipulative Geschick des Kurfürsten: Die moralischen Reflexe seiner Offiziere, ihre irrationalen Anwandlungen und die Labilität Homburgs versteht er in kriegerische Schlagkraft zu transformieren und zu bündeln und dabei sein psychologisches Raffinement hinter soldatischer Knappheit zu verstecken.
Die Disposition und die Gestaltung der Bühne (Hella Prokoph) stützen die Idee von der Emanzipation Homburgs ebenfalls nicht. Das Publikum nimmt Platz auf der Bühne und sieht von dort aus in den schwarz ausgeschlagenen Zuschauerraum.
Das St. Galler Theater, berühmt für seine «demokratische» Konzeption mit hervorragender Sicht von allen Plätzen, verkehrt sich vom Raum fürs Volk zum Raum für einen Militärstaat, die Stufen betonen dessen hierarchische Struktur, und in den weiten Räumen zwischen den Figuren scheint die Ohnmacht der Zivilgesellschaft zu gähnen. Viel mehr als Homburgs Emanzipation scheint hier Kleists eigenes Scheitern durch: Mit dem «Homburg» wagte er seinen letzten Versuch, dichterischen Ruhm zu erzwingen. Bei der preußischen Königsfamilie fand er damit keine Gnade.
Der Südkurier, 17.11.2009 von Peter E. Schaufelberger
In selbstverliebten Träumen
In aufrechtem Stolz, wiewohl halb träumend steht der Prinz von Homburg zu Beginn des Stücks vor dem Vorhang, sich bald halb einwickelnd in die weißen Stoffbahnen, dann wieder den Arm mit ausgreifender Geste hoch aufreckend. Als riesenhafte Schatten aber erheben sich auf der andern Seite Kurfürst und Kurfürstin, der Graf Hohenzollern und die Prinzessin Natalie von Oranien. Doch da ist kein Lorbeerkranz, den der Prinz sich wände, kein Handschuh, den er Natalie entwendete, kein Degen, den er trüge. Keine Fahnen und Standarten werden hereingetragen, wie Homburg und seine Offiziere dem Kurfürsten den Sieg vermelden, sondern schwarze Plastiksäcke voll weißer Wäschestücke.
Da ist nichts Äußerliches, was ablenken könnte von Kleists Text, nur eine düstere, schwarz ausgeschlagene Landschaft, treppenartig gegliedert unter schweren Leuchtern. Und an die Stelle des Schlachtenlärms und anderer Kulissengeräusche tritt die Musik von Jakob Diehl, beziehungsreich und voll atmosphärischer Sinnlichkeit, doch auch sie fernab jeder nur äußerlichen Realität.
Die junge Regisseurin Katja Langenbach hat das Publikum auf die Bühne verbannt und das Geschehen um den Prinzen von Homburg in den Zuschauerraum des Theaters St. Gallen verlegt. Sie nutzt zusammen mit ihrer Bühnenbildnerin Hella Prokoph die langen Gänge und die verschiedenen Ebenen, nutzt vor allem die Weite, in der sich die einzelnen Menschen bisweilen fast verlieren, als hätten sie nichts miteinander zu tun. Und sie findet Bilder, die sich einprägen.
In den obersten, in diesen Szenen abgedeckten Stuhlreihen ist der Platz des Kurfürsten, wenn er als Repräsentant des Staates und des Gesetzes auftritt; der Prinz, noch beim Gefängnisbesuch des Grafen Hohenzollern selbstsicher den Gnadenerlass des Fürsten erwartend, windet und dreht sich winselnd in einem von der Decke herabhängenden Fesselsitz, wie er die Nichtigkeit seiner Erwartung erkennt. Und wie Hohenzollern dem Fürsten selbst die Schuld an Homburgs Vergehen anlasten will, stehen sich beide ganz oben auf dem Balkon auf gleicher Höhe gegenüber, scheint die Rangordnung für kurze Augenblicke aufgehoben.
Bilder, sinnenfällig, herausgehoben aus dem Schwarz meist nur durch gezielt geführtes Licht und doch im Nächtlichen verharrend, als ob sie nicht dem Tag, vielmehr dem Traum gehörten. Denn in selbstverliebten Träumen bewegt sich auch Homburg, bis die Realität ihn einholt und ihm buchstäblich den Boden unter den Füssen wegreißt, ihn hängen lässt in der Hilflosigkeit des Ausgeliefertseins und der Angst und ihn schließlich zur Einsicht seines Fehlens als Voraussetzung für eine Begnadigung führt.
Nikolaus Bendamacht diese Selbstverliebtheit als Grundzug des Prinzen mit feinster Nuancierung deutlich, lässt sie mitschwingen noch im Augenblick, in dem er sich dem Urteil unterwirft und auf Natalie verzichtet; sein letztes Wort „Nein, sagt! Ist es ein Traum?“, ungläubig gesprochen im Augenblick höchster Erhebung, setzt ihn nochmals ab von der realen Welt, in der er, der eigentlich Todgeweihte, als Sieger von Fehrbellin gepriesen und zum Führer in kommenden Schlachten erwählt wird.
Ebenbürtiger Widerpart ist ihm der Kurfürst von Alexandre Pelichet, zurückhaltend in seinem ganzen Auftreten, unerbittlich zwar am Gesetz festhaltend, doch im Gegensatz zum Prinzen nicht vorab zu eignem Ruhm, sondern zum Wohl des Staates. Doch Pelichet macht bei aller fast stur wirkenden Gradlinigkeit auch die weiche, empfindsame Seite des Kurfürsten deutlich – in kleinen, behutsamen Gesten, mit denen er seine Worte unterstreicht.Um diese zentralen Gestalten gruppiert Katja Langenbach die wenigen Rollen, die sie aus Kleists Personenfülle beibehalten hat: den treuherzig-markigen Obersten Kottwitz (Hans Rudolf Spühler), den Grafen Hohenzollern als besorgten und umsorgenden Freund des Prinzen (Hannes Perkmann), den Feldmarschall Dörfling (Matthias Albold) und einen Rittmeister (Marcus Schäfer), dazu die Kurfürstin (Diana Dengler) und die Prinzessin Natalie (Boglárka Horváth). An Kleists Text allerdings hat sie kaum etwas verändert, ihn nur auf wesentlich weniger Personen verteilt -zum Vorteil einer konsequenten Konzentration auf die innere Handlung und einer Dichte von Spiel und Geschehen, die bisweilen kaum noch das Atmen gestattet.